HERAUSFORDERUNG EINER TRANSFORMATION DER KULTURPOLITIK
Der Wunsch nach einem Dialog zwischen freien Akteur_innen der Kulturszene und Entscheidungsträger_innen der Kulturpolitik steht vor mehreren Zwängen und Herausforderungen, insofern er Grundentscheidungen der bisher durchgeführten Kulturpolitik in Frage stellt. Dabei möchte man die Grundfragen der Kulturpolitik aus einer erneuerten Perspektive betrachten: Was ist Kultur bzw. was sind Kulturen? Warum ist die Kultur eine öffentliche Aufgabe? Welche Kultur soll in einer Stadt gefördert bzw. geschützt werden? Diese Aspekte sind schon vielfach diskutiert worden. Die langwierigen Diskussionen, die sich seit Jahrzehnten in Deutschland um »das Volk der Dichter und Denker« statt »dem Volk der Richter und Henker« entfalten, haben zum Teil dazu geführt, dass der hohe Stellenwert der Kultur in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich anerkannt wurde. Diese symbolischen und repräsentativen Errungenschaften, auch wenn sie wertvolle Grundsteine bilden, müssen jedoch weiter ausgebaut und vor allem inhaltlich zeitgemäß erfasst werden. Eine sich im Wandel begriffene Gesellschaft benötigt eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Kulturpolitik und deren Funktion auf Ebener einer Stadt, einer Region oder eines Landes.
Die vielfältigen Diskussionen des Kongresses haben gezeigt, dass der Stellenwert der Kultur momentan nicht vollständig erkannt wird. Zwar ist die Wichtigkeit der Kultur für die Gesellschaft gesetzlich festgelegt, jedoch bleibt dessen Umfeld von einer akuten Ressourcenknappheit geprägt, was eine Umsetzung und Entfaltung zeitgenössischer Kulturproduktion nur begrenzt ermöglicht (1). Die Beiträge der Kongressreferent_innen sind einstimmig: Die Beibehaltung der Tradition spielt eine wichtige Rolle. Die finanzielle aber auch symbolische Last der Kulturinstitutionen in öffentlicher Hand führt zu einer gewissen Versteifung der Kulturpolitik. Die lauteste Gegenstimme dazu ist eine Auffassung der Kulturpolitik, die vor einer verstärkten Funktionalisierung von Kultur nicht zurückschreckt. Nach dieser Auffassung sollte die Kulturpolitik auch Wirtschaftspolitik, Stadtpolitik bzw. Sozialpolitik sein (2).
Wie kann sich die Freie Szene in diesem Milieu behaupten? Wie soll sie als gleichwertiger Player im Kunstfeld wahrgenommen werden? Die wichtigste kulturpolitische Herausforderung der Freien Szene liegt in der Unschärfe ihrer Definition: Was ist die Freie Szene und wer gehört zu ihr? Während des Kongresses sind unterschiedliche Definitionen und Vorstellungen dazu hervorgetreten (3).
1. Stellenwert Kultur: Anerkennung als rares Gut
»Das, was von einer Gesellschaft bleibt, ist ihre Kultur. Sie ist nicht nur Ornament, sondern das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht und auf das sie baut.« (Enquete‑Kommission, 2007)
Ist die Anerkennung des Stellenwertes der Kultur wirkungslos?
Einige juristische Texte wurden in den letzten Jahrzehnten verfasst, die den Stellenwert von Kultur genau festlegen und sich dabei für ihren Förderung und Schutz einsetzen. Auf der internationalen Ebene gilt seit 2005 die UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Deutschland, auch wenn der Stellenwert der Kultur bisher nicht im Grundgesetz verankert ist (Stichwort Frage der Kulturstaatlichkeit), versteht sich als Kulturnation und Kulturstaat (Artikel 5 des Grundgesetzes). Wie die Autor_innen der Enquete- Kommission »Kultur in Deutschland« notierten, drückt sich dies »in der Kulturverantwortung der Kommunen, den Verfassungen der Länder und der Praxis des Bundes in seinem Kompetenzbereich aus«(Enquete-Kommission, 2007, S.4). In der Tat wird die Zuständigkeit für die Kultur- und Bildungspolitik im Wesentlichen den Ländern zugeschrieben (Stichwort Kulturhoheit der Länder).
Die Zuständigkeit der Kulturförderung ist dementsprechend in den Landesverfassungen verankert, so etwa in Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung für Nordrhein-Westfalen: »Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu fördern«. Aus juristischer Sicht stellt sich jedoch die Frage, ob die vermeintliche Pflicht zur Kulturfinanzierung wegen fehlender Konkretisierung als freiwillige Aufgabe aufgefasst wird. Sollte sie nicht besser eine Pflichtaufgabe werden, um den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft zu verankern? Diese Frage hat eine lebendige Diskussion im Verlaufe des Kongresses geweckt.
 Prof. Dr. Wolfgang Schneider
Prof. Dr. Wolfgang Schneider
Universität Hildesheim
Hildesheim
mehr zur personProf. Dr. Wolfgang Schneider, als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« hat über einen der ersten Beschlüsse der Kommission berichtet; und zwar über den Vorschlag zur Grundgesetzänderung »Staatsziel Bestimmung«Paragraph 20b: »Der Staat stützt und fördert die Kultur«. Er vertrat die Position dass diese Änderung die Legitimation der Kultur im kommunalen Raum stärken würde. Die Kultur sollte genauso wie z.B. städtische Reinigungsbetriebe und andere kommunale Dienste zur »Daseinsvorsorge« gehören.
 Klaus Hebborn
Klaus Hebborn
Deutsche Städtetag
Berlin
mehr zur person Klaus Hebborn, Beigeordneter des Deutschen Städtetages, antwortete als Gegenredner, dass er den Ausdruck »freiwillige Aufgabe Kultur« vermeidet und lieber von »kommunaler Selbstverwaltungsaufgabe Kultur« spricht. Beide Auffassungen müssen strikt von einander getrennt werden: »In der Selbstverwaltungsaufgabe steckt ein Gestaltungsaspekt. Man könnte Kultur zur kommunalen Pflichtaufgabe machen, wie die von Ihnen genannten Bereiche [Müllabfuhr, Straßenpflege]. Aber dann muss man sich bewusst werden, dass es dann mit der Gestaltungsfreiheit relativ schnell vorbei ist«. Kindergärten sind dafür ein gutes Bespiel. Sie sind Pflichtaufgabe und werden durch sehr detaillierte Vorgaben geregelt. Herr Hebborn betonte dabei, dass Kulturpolitik eine Aufgabe sei, die nur weisungsfrei, sprich ohne staatliche Vorgabe, agieren könnte. Daran orientiert sich der Deutsche Städtetag.
 Michael Faber
Michael Faber
Stadt Leipzig
Leipzig
mehr zur person Michael Faber, Kulturbürgermeister und Beigeordneter für Kultur der Stadt Leipzig, hat ebenfalls die Schwierigkeit einer Gesetzlichkeit der Kultur vermerkt. Er und andere Referent_innen haben in dieser Hinsicht den Freistaat Sachsen als rühmliches Beispiel hervorgehoben. Der Freistaat Sachsen hat als einziges Bundesland Deutschlands ein Klaus Hebborn sogenanntes »Kulturraumgesetz« zu seiner Verfassung beigefügt (Artikel 11 der Sächsischen Verfassung). Diese Klausel setzt das gemeinsame Zusammenwirken mit Kulturräumen, Kreisen, Kommunen und Land fest. In diesem Sinne ist es »kein klassisches Pflichtaufgabengesetz, sondern ein Zusammenarbeitsgesetz«, so Klaus Hebborn. Das Kulturraumgesetz stellt ein innovatives Konzept dar, indem es die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Verwaltungsebenen (Land, Kulturräume, Kreise, Kommunen) festlegt und damit finanzielle Zuständigkeiten genau vorgibt. Andere Stimmen im Kongress haben den Aspekt Zusammenarbeit jedoch hinterfragt, weil die Gefahr bestünde, dass das Land »ausschließlich« Gelder an die Kommunen vergibt und dabei gar keine Rolle in der Gestaltung der Kulturpolitik einnimmt. Die Kommunen werden zwar finanziell entlastet, sie bleiben aber für die Verteilung der Gelder einzeln verantwortlich.
In der Tat liegt die Schwierigkeit nicht bei der Anerkennung des Stellenwertes der Kultur, sondern viel mehr bei der Zuweisung der finanziellen Zuständigkeit unter den Verwaltungsebenen, also sprich in der konsequenten Umsetzung dieser Anerkennung. Die öffentliche Hand erkennt zwar offiziell die unbestreitbare Rolle der Kultur für die demokratische Entwicklung der Gesellschaft an, weigert sich aber die angemessenen Mittel zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien, wie z.B die, die von
 Dr. Mariusz Piotrowski
Dr. Mariusz Piotrowski
Living Culture Observatory
Warschau (PL)
mehr zur person Dr. Mariusz Piotrowski im Rahmen des Kongresses vorgestellt wurde. In dieser u.a. von
»Kultura pod pochmurnym niebem – Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur« [Kultur unter bewölktem Himmel – Dynamische Diagnose der Kultur in Ermland und Masuren] Prof. Barbara Fatyga herausgegebenen Arbeit wurde der Stellenwert der »lebendigen Kultur« festgestellt und wie diese zum Tragen kommt. Die Untersuchung stellte fest, dass bindende juristische Instrumente für die Förderung und den Schutz der Kultur bisher fehlen.
Neben dem Vorschlag einer Grundgesetzänderung bestehen Ideen zur Durchsetzung einer sogenannten »Kulturverträglichkeitsprüfung«, z.B. bei großen Bauplanungsvorhaben. Dies würde eine weitere Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Kultur bilden. Die Referent_innen beim Kongress begrüßten einstimmig diesen Vorschlag und erweiterten ihn zum Teil zu einer Grundanforderung an jegliches staatliches Handeln. Dies soll später genauer erläutert werden.
Ressourcenknappheit an der Tagesordnung
 Die gesellschaftliche und gesetzliche Anerkennung der Kultur spiegelt sich laut Kongressteilnehmer_innen noch nicht in den zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel wider. Zwar steigt der Kulturhaushalt der öffentlichen Hand (Bund, Ländern und Gemeinden), aber im Kontext eines gesellschaftlichen Strukturwandels in Richtung einer Wissensgesellschaft sind die finanziellen Mittel nicht ausreichend. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat die öffentlichen Ausgaben für Kultur für das Jahr 2009 zusammengefasst: »laut dem 2012 von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder veröffentlichten Kulturfinanzbericht stiegen die Kulturausgaben der öffentlichen Hand von 1995 bis 2009 um 22,2 Prozent auf 9,13 Milliarden Euro. Dabei fielen 13,4 Prozent der Ausgaben auf den Bund, 42,2 Prozent auf die Länder und 44,4 Prozent auf die Gemeinden/Zweckverbände« (bpb, 2014).
Die gesellschaftliche und gesetzliche Anerkennung der Kultur spiegelt sich laut Kongressteilnehmer_innen noch nicht in den zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel wider. Zwar steigt der Kulturhaushalt der öffentlichen Hand (Bund, Ländern und Gemeinden), aber im Kontext eines gesellschaftlichen Strukturwandels in Richtung einer Wissensgesellschaft sind die finanziellen Mittel nicht ausreichend. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat die öffentlichen Ausgaben für Kultur für das Jahr 2009 zusammengefasst: »laut dem 2012 von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder veröffentlichten Kulturfinanzbericht stiegen die Kulturausgaben der öffentlichen Hand von 1995 bis 2009 um 22,2 Prozent auf 9,13 Milliarden Euro. Dabei fielen 13,4 Prozent der Ausgaben auf den Bund, 42,2 Prozent auf die Länder und 44,4 Prozent auf die Gemeinden/Zweckverbände« (bpb, 2014).
Die Frage der finanziellen Zuständigkeit hat beim Kongress starke Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wer soll die Kulturausgaben übernehmen? Die Rolle des Bundes tendiert dazu an Bedeutung zuzunehmen. Das 1998 geschaffene Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hat vor kurzem eine Steigerung des kulturellen Haushaltes für 2016 um 56 Millionen Euro angekündigt (d.h. 4,4% mehr im Vergleich zu 2015). Diese durchaus begrüßenswerte Entwicklung bedeutet gleichzeitig keine Linderung der kaum zu überwindenden finanziellen Last der Kulturausgaben, die auf den Kommunen lasten. Die Freiwilligkeit der Kulturaufgabe führt dann in vielen Fällen dazu, dass der Kulturhaushalt in Konkurrenz zu anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen akut in Frage gestellt wird. Gegenüber Kitas oder Instandhaltung der Straßen steht Kultur weiterhin nur als ein Sahnehäubchen für die Gesellschaft da. In der alltäglichen kommunalen Governance muss der Stellenwert der Kultur stets erneut behauptet und verteidigt werden.
2. Unterschiedliche kulturpolitische »Repertoires«
Die Anerkennung des Stellenwertes der Kultur ist die erste Herausforderung. Sie bestimmt, wie viele Spielräume der Kultur insgesamt zugeschrieben werden. Dabei wird jedoch nicht festgelegt, welche Kultur gemeint ist, der Priorität gegeben wird. Dies wiederum bestimmt die Aufteilung der, wie vorhin festgestellt, durchaus begrenzten Gelder. Die Frage der Priorisierung von bestimmten Formen von Kultur ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern weist auch auf eine ideologische Auffassung der Kulturpolitik hin. Die Frage nach der Kategorienbildung der Kulturpolitik (bzw. der cultural policy) wurde im Rahmen des Kongresses als zentraler Punkt behandelt.
 Prof. Dr. jur. Oliver Scheytt
Prof. Dr. jur. Oliver Scheytt
Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
Essen
mehr zur person Prof. Dr. Oliver Scheytt hat in diesem Zusammenhang vom Dilemma Bedeutung bzw. Stellenwert gesprochen. Welche Bedeutung wird Kultur zugewiesen? Welche Werte, welche Symbolik, welche gesellschaftlichen Ziele soll sie vermitteln?
Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Oliver Scheytt
Die französische Politikwissenschaftlerin Pascale Laborier hat anhand einer Untersuchung der Legitimationsprozesse der öffentlichen Handlung im Kulturbereich im vereinigten Deutschland den Begriff des »Repertoires« in der Kulturpolitik herausgearbeitet. Damit meint sie »die Zusammensetzung von Theorien, Argumenten, Doktrinen, die allmählich einen Wortschatz bilden, mit dem sich die Akteure die Legitimität der öffentlicher Handlung im Kulturbereich und deren Modalitäten darstellen« (Laborier, 1996, S. 116). Laborier hat in den 1990er Jahren drei Repertoires herausgearbeitet: das Legitimistische (Stichwort Hochkultur), das Relativistische (Stichwort Soziokultur) und das Freiheitlich-rationale (Stichwort Kultur als Instrument). Obwohl der Kongress gezeigt hat, dass die neuesten Entwicklungen des Feldes der kulturellen Produktion und die Bildung einer Freien Szene dazu tendieren diese tripolare Denkstruktur auf die Probe zu stellen, fungieren diese Bedeutungszuweisung dennoch als Ecksteine der Kulturpolitik.
Die finanzielle und symbolische Last der staatlichen Kulturinstitutionen
Es gab viele Stimmen im Laufe des Kongresses, die die finanzielle und symbolische Last der Kulturinstitutionen in der öffentlichen Hand (bzw. Staatlichen Kulturinstitutionen) hervorhoben bzw. denunzierten. Die staatlichen Institutionen vereinnahmen generell nicht weniger als 95% der kommunalen Kulturhaushalte. 5% bleiben dann als Spielraum übrig, um andere Akteur_innen zu finanzieren. Wie soll man mit dieser Feststellung umgehen? Was für Auswirkungen hat sie?
Klaus Hebborn, Beigeordneter des Deutschen Städtetags, hat das Dilemma der Kommunen deutlich dargestellt, die durch Konservatismus, im Sinne von der Erhaltung des Bestehenden, und Innovatismus, im Sinne von der Förderung des Zukünftigen, zwiegespalten sind. Wo sollen die Schwerpunkte gesetzt werden? In dem von Ressourcenknappheit geprägten Kontext tendiert die öffentliche Hand eher zum Erhalten von Kultur. In einer trefflichen Metapher von
 Daniela Rathe
Daniela Rathe
Stadt Tübingen
Tübingen
mehr zur person Daniela Rathe, damalige Kulturamtsleiterin der Stadt Tübingen, wird dies deutlich: »Der Bus ist voll, jemand steigt ein, nur wenn einer aussteigt«.
Die Last der öffentlich gesteuerten Kulturinstitutionen wurde im Detail in dem mittlerweile vielfach rezipierten Buch »Der Kulturinfarkt« thematisiert. Einer der vier Autoren,
 Prof. Dr. Dieter Haselbach
Prof. Dr. Dieter Haselbach
Zentrum für Kulturforschung
Berlin
mehr zur person Prof. Dr. Dieter Haselbach, Soziologe und Unternehmensberater für Kulturbetriebe, war beim Kongress vertreten. Er hat die These einer notwendigen »Entinstitutionalisierung der Institutionen« verteidigt. Auch wenn seine These im Kongress auf viel Kritik und Ablehnung gestoßen ist, wurde seine Argumentation im Hinblick auf bessere Evaluierungsmechanismen der Institutionen breit diskutiert. In der Tat, wie uns Prof. Dr. Schneider versichert hat: »Kein Staatstheater, kein Museum muss sich mit einem Konzept legitimieren«. Sein Dasein ist seine Berechtigung. Im Gegensatz dazu werden die freien Träger um ständige Rechtfertigung gebeten.
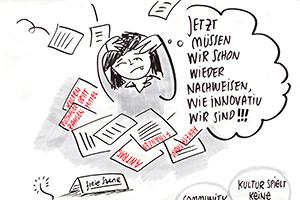
Dieses Fehlen an Evaluierung weist auf einen bestimmten Glauben hin: Die öffentlich gesteuerten Kulturinstitutionen wären die einzigen berechtigten Depositare der wahren Hochkultur. In dieser Hinsicht wird Kultur als ein gemeinsames und universales Gut und Ideal verstanden, das von einer ausgebildeten Elite produziert wird und im Zuge einer Aufklärungsaufgabe dem breiten Volk nicht vorenthalten werden darf (Stichwort: Demokratisierung der Kultur). Das entspricht dem »legitimistischen Repertoire« von Laborier. Viele Stimmen im Kongress plädierten für eine Revidierung einer als veraltet empfundenen Auffassung des Kulturbegriffs. Diese Revidierung kann auf mehreren Ebenen argumentiert werden. Während einige Teilnehmer_innen des Kongresses widerlegten, dass öffentlich gesteuerte Kulturinstitutionen allein qualitative hochwertige Kultur produzieren würden, stellten andere Teilnehmer_innen wiederum die Dichotomie zwischen Hoch- und z.B. Soziokultur selbst in Frage.
Eine soziale Funktionalisierung
Neben der Last der legitimistischen Institutionen wurden während dem Kongress zwei Sachzwänge identifiziert, die dazu führen, den kulturpolitischen Spielraum einzuschränken. Es wurde auf Funktionalisierungstendenzen verwiesen, die sich sowohl auf einer sozialen als auch auf einer ökonomischen Ebene entfalten.
 Dr. Skadi Jennicke
Dr. Skadi Jennicke
Die Linke
Leipzig
mehr zur person Dr. Skadi Jennicke, Dramaturgin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Kulturpolitische Sprecherin von DIE LINKE im Leipziger Stadtrat, hat den »Zwang einer Funktionalisierung der Kultur« aufgegriffen. In der Tat wurde die Herausforderung des hohen Flüchtlingsaufkommens mehrmals als eine spezifische Zuständigkeit des Kulturbereichs ausgewiesen. Dies kam zum Tragen in der Eröffnungsrede von Uwe Gaul, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Freistaats Sachsen und im Beitrag von Torsten Bonew, Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen der Stadt Leipzig, aber auch in den Beiträgen von Michael Faber, Kulturbürgermeister und Beigeordneter für Kultur der Stadt Leipzig und von
 Martin Schumacher
Martin Schumacher
Stadt Bonn
Bonn
mehr zur person Martin Schumacher, Dezernent für Kultur, Sport und Wissenschaft der Bundesstadt Bonn. Es ist nicht zu leugnen, dass die Integration von Flüchtlingen eine bisher unvorhersehbare kulturelle Dimension und Aufgabe darstellt, was aber die zukünftige kulturpolitische Mittelvergabe nicht auf diese Fragestellung reduzieren sollte.

 Es hieß mehrmals während des Kongresses, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik sei. Damit wird das zweite kulturpolitische Repertoire von Laborier angesprochen (das sogenannte »relativistische Repertoire«), das auf die Berücksichtigung der Wünsche der Bevölkerung und auf deren Vielfalt beruht. Der Schutz und die Förderung von kulturellem Gut von Minderheiten, ob ethnisch, sexuell, sozial, religiös, soll durch die Bildung einer offenen und multikulturellen Gesellschaft zu einer Aufwertung des Alltags führen. Es entspricht in vieler Hinsicht der Programmatik der sogenannten »Soziokultur« (Stichwort kulturelle Demokratie).
Es hieß mehrmals während des Kongresses, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik sei. Damit wird das zweite kulturpolitische Repertoire von Laborier angesprochen (das sogenannte »relativistische Repertoire«), das auf die Berücksichtigung der Wünsche der Bevölkerung und auf deren Vielfalt beruht. Der Schutz und die Förderung von kulturellem Gut von Minderheiten, ob ethnisch, sexuell, sozial, religiös, soll durch die Bildung einer offenen und multikulturellen Gesellschaft zu einer Aufwertung des Alltags führen. Es entspricht in vieler Hinsicht der Programmatik der sogenannten »Soziokultur« (Stichwort kulturelle Demokratie).
Dabei wurde aber mehrmals auf die gefährliche Tendenz hingewiesen, Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik zu verstehen, um diese dann mit Integrations- und Bildungspolitik gleichzusetzen. Künstlerische und kulturelle Projekte haben gesellschaftliche Wirkung, aber dabei dürfen sie nicht ausschließlich auf dieses Ziel beschnitten werden. Die gesellschaftliche Relevanz der Kunst entfaltet sich in der Freiheit der Künstler_innen und der Kulturschaffenden.
Eine (kreativ-)wirtschaftliche Funktionalisierung
Der zweite Sachzwang wurde von Dr. Skadi Jennicke als Ökonomisierungseffekt beschrieben, was anders gesagt als eine ökonomische Funktionalisierung der Kunst und Kultur verstanden werden kann. Der dominierende Diskurs um die kreative Stadt (Stichwort: Richard Florida, creative class und creative city) bedeutet, dass sich Kultur zunehmend als ein wirtschaftliches Instrument legitimieren muss. Während des Kongresses wurde von mehreren Referent_innen und Teilnehmer_innen die zunehmende Erwartungshaltung an Künstler_innen und Kulturschaffende und die daraus resultierenden Zwänge thematisiert, aus kulturellen und künstlerischen Tätigkeiten eine lukrative und rentable Beschäftigung zu machen. Dabei wurde deutlich gemacht, dass Kommunen zunehmend die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur auf ihre ökonomischen Effekte reduzieren. Damit wurde eine gewisse Verworrenheit der Begrifflichkeit von Kultur im Verhältnis zur Kreativwirtschaft deutlich. Mit der Durchsetzung der These von Florida zur kreativen Stadt und kreativen Klasse, wird Kultur immer mehr als ein reiner Wirtschaftsfaktor wahrgenommen und auch als solcher gefördert. Mehrere Referent_innen haben in dieser Hinsicht auf den Einfluss der EU-Richtlinien aufmerksam gemacht.
Es wurde ebenso zwiespältig über das Programm »Kulturhauptstadt Europas« als Instrument der Kulturförderung berichtet. Michal Hladký, Designer und Projektleiter der europäischen Kulturhauptstadt Košice 2013, hat davon berichtet, wie dabei die wirtschaftlichen und wachstumsorientierten Erwartungen mit dem künstlerischen Bestreben der Kulturschaffenden zusammenspielen müssen. Die Kulturhauptstadt, u.a. als ein Instrument des Stadtmarketings, sollte sowohl für die EU als auch für die jeweiligen Stadtverwaltungen zur Optimierung des Standorts führen. Er berichtet davon, dass es aus der Notwendigkeit, zwischen den verschiedenen Akteur_innen-Gruppen zu vermitteln, dazu kam, dass die kreativwirtschaftliche Auslegung solcher ursprünglich als kulturell angelegten Projekte unausweichlich geworden ist.
In der lokalen Politik spiegelt sich diese Haltung der Kulturförderung als Wirtschaftsfaktor ebenfalls wieder. Michał Sowiński, unabhängiger Kulturproduzent und Verleger aus Krakau, hat über die Festivalisierung der Kultur in seiner Stadt berichtet. Die Kulturförderung konzentriert sich oftmals ausschließlich auf Veranstaltungen im Rahmen von Festivals. Damit hofft die Stadt Krakau ihr Image zu verbessern, um mehr Touristen anzulocken. Dies wiederum bedeutet eine zeitlich begrenzte Förderperiode für Kunst- und Kulturschaffende, was Kulturarbeit als Saisonarbeit degradiert und die Bürger_innen einer Stadt, die dort das ganze Jahr über leben und Anspruch auf Kulturangebote haben, völlig außer Acht lässt. Vor diesem Hintergrund kann sich keine dauerhafte kulturelle Landschaft entwickeln. Diese Auffassung der Kulturpolitik entspricht dem dritten Repertoire von Laborier, dem freiheitlich-rationalen Repertoire, das auf einem angeblichen »bedeutungsfreien« Ansatz der Kultur beruht. Dort verstehen sich die öffentlichen Entscheidungsträger_innen nur als Techniker_innen bzw. Verwalter_innen und positionieren sich als apolitisch. Dadurch negieren sie jeglichen ideologischen Hintergrund an ihrer Handlung, obwohl sie diesen besitzen. Die Kultur wird vor allem aus der Perspektive ihrer Wirkung und nicht ihres Inhaltes eingesetzt.
Als Schlusspointe stellt sich die Frage nach den Künstler_innen. Wo bleiben diese im Rahmen der drei vorgestellten Auffassungen der Kulturpolitik? Sollte Kulturpolitik nicht vor allem aus dem Bedürfnis der Kunst- und Kulturschaffenden heraus erarbeitet werden (s. als Vertiefung den Artikel von Prof. Dr. Schneider)? »Konzertierte Wertschätzung statt prekärer Arbeitsbedingungen! Plädoyer für eine Kulturpolitik im Interesse von Künstlern« von Prof. Dr. Wolfgang Schneider
3. Eine Frage der Definition : Was ist die Freie Szene?
Die Darstellung der Zwänge, die auf der Kulturpolitik lasten machen deutlich, wie gering der Spielraum für eine freie Entwicklung von Kunst und Kultur ist. Wie passt die Freie Szene in dieses Schema? Wie kann sich die Freie Szene dabei einen Raum gestalten? Die erste Frage dazu ist definitorisch: Was ist die Freie Szene? Im Laufe des Kongresses wurde deutlich, dass dazu noch kein gemeinsamer Konsens besteht und dass nicht festgelegt ist, aus welchen Komponenten die Freie Szene besteht. Als Synonym wurde immer wieder Soziokultur oder Kreativwirtschaft erwähnt, während als Antonym allgemein von Institutionen gesprochen wurde. Die Analyse der unterschiedlichen Haltungen zeigt gewisse Überlappungen und klare Abgrenzungen der Freien Szene gegenüber diesen alternativen Begriffen, die auf konkurrierende Auffassungen von Kultur verweisen.
Ein Bündnis freier Träger?
Die erste Bemerkung dazu kommt aus juristischer Sicht. Wie Michael Faber, Kulturbürgermeister und Beigeordneter für Kultur der Stadt Leipzig, aber auch Christophe Knoch,
 Christophe Knoch
Christophe Knoch
Koalition der Freien Szene aller Künste
Berlin
mehr zur person Sprecher der Koalition der Freien Szene aller Künste Berlin, es bekräftigen, verweist der Ausdruck Freie Szene auf die Form der freien Trägerschaft hin. In dem Zusammenhang wird frei als »nicht von der öffentlichen Hand gesteuert« verstanden. Deshalb ist das Gegensatzpaar Freie Szene / Institution eine grobe und falsch liegende Vereinfachung, insofern man überhaupt von »freien Institutionen« sprechen kann. Das Soziokulturelle Zentrum naTo in Leipzig als ein Beispiel organisiert sich selbst, ist aber trotzdem durch gewisse finanzielle Gegebenheiten von Geldgebern abhängig.
Aber genügt diese rein juristische Definition? Im Kongress gab es lebendige Diskussionen um die notwendige Abgrenzung zwischen Freier Szene und Kreativwirtschaft. Rein juristisch verkörpert ein Freischaffender im Bereich der Kreativwirtschaft auch Trägerschaft. Jedoch widerlegten viele Stimmen diese Einbindung der Kreativen in die Freie Szene als eine akute Widerspiegelung des soeben beschriebenen Ökonomisierungsdrucks. Akteur_innen der Freien Szene sollen nicht kommerziell agieren und in diesem Sinne sich nicht unter dem Slogan der Kreativwirtschaft einordnen. Hier erscheint das Dritter-Sektor Modell (Zimmer & Priller, 2007) hilfreich, wie
 Dr. Eckhard Braun
Dr. Eckhard Braun
Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
Leipzig/Wittlich
mehr zur person Dr. Eckhard Braun, Jurist und Kulturmanager an der Universität Leipzig, es zitierte:
Der Bereich des Marktes bezieht sich auf gewinnorientierte und generell über den Markt finanzierte
kulturelle Tätigkeit. Der Bereich des Staats weist auf das Handeln aller Gebietskörperschaften mit Ziel der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben hin. Der Dritte Sektor, auch Non-Profit-Sektor oder allgemein als Zivilgesellschaft verstanden, verweist auf private, nichtkommerzielle Organisationen, die Leistungen und Dienste im öffentlichen Interesse und für das allgemeine Wohl erbringen oder finanzieren. Die Freie Szene, so wie wir sie hier verstehen, ist zweifellos im Dritten Sektor verankert.
Die Freie Szene und die Soziokultur
Nach diesen ersten Präzisierungen scheint es, als wäre ein zweiter Schritt notwendig, und zwar, über das Verhältnis zwischen Soziokultur und Freier Szene nachzudenken, was während des Kongresses für große Verwirrung sorgte. Einige Teilnehmer_innen hatten beide Ausdrücke als Synonym verwendet, wie z.B. Prof. Dr. Schneider, während andere wiederum das Zusammenspiel zwischen den beiden Feldern zum Ausdruck brachten. Zum Beispiel hat Annette Körner,
 Annette Körner
Annette Körner
Bündnis 90/Die Grünen / Stadt Leipzig
Leipzig
mehr zur person kultur- und wirtschaftspolitische Sprecherin des Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat und Vorsitzende des Kulturausschusses in Leipzig, von einer »Verzahnung der Freien Szene mit der Soziokultur« gesprochen.
Die Soziokultur beruht, wie schon oben angedeutet, auf einer bestimmten Auffassung von Kultur und dementsprechend auch von Kulturpolitik. Die Soziokultur wird als »eine gemeinwesensorientierte, sparten-, themen-, ressort- und generationsübergreifende Kulturpraxis verstanden, die eine breite Teilnahme der Bevölkerung anvisiert. [Sie] zielt auf kulturelle Bildung der Individuen und kulturelle Gestaltung von Gesellschaft im weitesten Sinne« (Landesverband Soziokultur Sachsen e.V.). In anderen Ländern wird eher von »community work« gesprochen. Mehrere Referent_innen haben darauf hingewiesen, dass trotz der Anerkennung der Soziokultur im deutschsprachigen Kontext seit den 1970er Jahren das Verständnis seitens der öffentlichen Förderer sehr gering blieb. Diana Wesser,
 Diana Wesser
Diana Wesser
Leipziger Stadtteilexpeditionen
Leipzig
mehr zur person Performancekünstlerin aus Leipzig, Leiterin von Festivals und Kunstprojekten im öffentlichen Raum, hat sich wie folgt zur aktuellen Situation in Leipzig geäußert: »Es ist vielen noch nicht bewusst, dass diese Form [community work bzw. Soziokultur] Kunst ist. Es ist auf der anderen Seite auch nicht gesagt, dass dies nur Kunst ist. […] Das ist ein aktivistisches Projekt. Wir wollen die Gesellschaft gestalten, nicht nur mit der Gesellschaft oder über die Gesellschaft arbeiten«.
Die Soziokultur gehört zur Freien Szene. Aber die Freie Szene ist nicht mit Soziokultur gleich zu setzen. Die freie Szene beherbergt andere Kunst- und Kulturverständnisse als diejenigen der Soziokultur. Eine Wortmeldung von Christophe Knoch, Sprecher der Koalition der Freien Szene aller Künste Berlin, hat dies besonders zum Ausdruck gebracht: »diese Idee dass nur die [öffentlich gesteuerten] Institutionen ernsthafte Kunst produzieren [ist nicht mehr vertretbar]. Die Freie Szene produziert auch ernste Kunst«. Hier wird deutlich, dass andere Produzent_innen aus der Freien Szene eher eine avantgardistische Kunst (Stichwort: Autonomie oder l’art pour l’art (Bourdieu, 1997)) vertreten. Aus dem Grund ist es nicht möglich, die Freie Szene auf die Soziokultur zu reduzieren.
Diese Verschwommenheit der Begrifflichkeit um die Freie Szene bildet eine große Herausforderung für die Kulturpolitik, insofern die Freie Szene die tripolare Denkstruktur (Hochkultur, Soziokultur, Instrument) übersteigt. Teilweise könnte sie ein bestimmtes Repertoire aber im Ganzen verschwimmen dabei die von Laborier festgelegten Repertoires. Was braucht eine Transformation der Kulturpolitik? Wie kann sie gestaltet werden?


